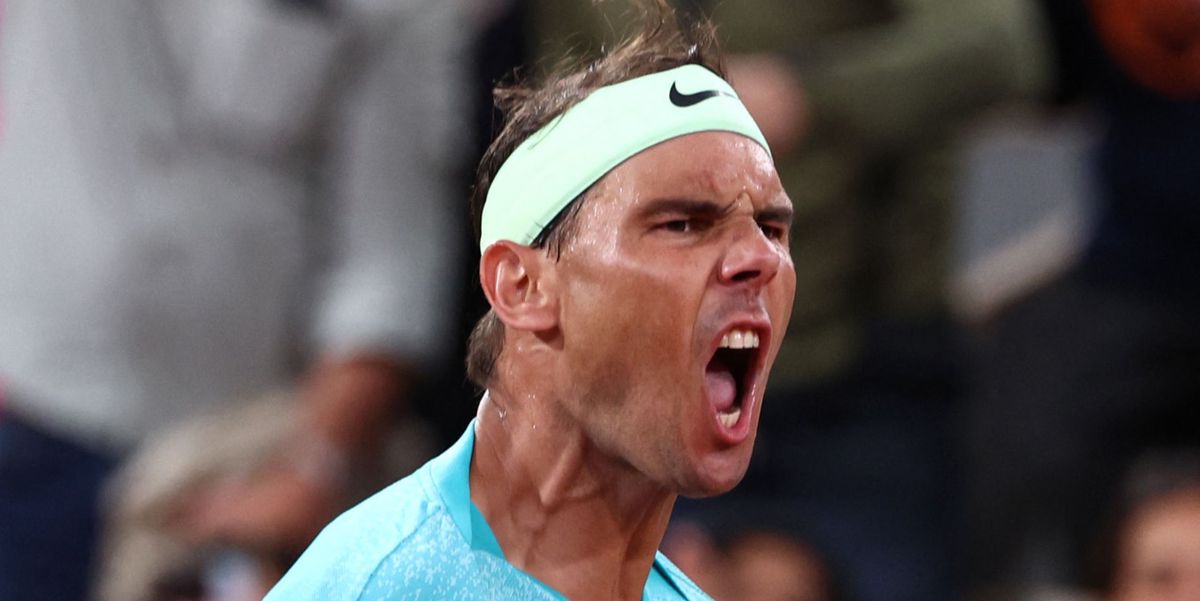Europa-Vergleich zur Energiewende Schweiz liegt auf Rang 23 – und ist fast Schlusslicht
Die Schweiz baut erneuerbare Energien im Vergleich langsam aus. Immerhin beim Solarstrom liegt sie in den Top 10. Ein Professor befürchtet, dass die Politik die Weichen falsch stellen könnte.

Was eint Lettland, Slowenien, Tschechien, Ungarn und die Slowakei? Die fünf Länder haben letztes Jahr in Europa pro Kopf gerechnet weniger Solar- und Windstrom als die Schweiz produziert. Eine Adelung ist das für unser Land freilich nicht, rangieren doch die übrigen 22 EU-Staaten vor der Schweiz. Das zeigt der Ländervergleich 2021, den die Schweizerische Energie-Stiftung am Dienstag publiziert.
Der Schweizer Wert liegt bei 373 Kilowattstunden pro Kopf. Zum Vergleich: Spitzenreiter Schweden und Dänemark haben pro Kopf achtmal mehr Strom aus Sonne und Wind hergestellt, auch Deutschland und Österreich sind deutlich vor der Schweiz. Die Energie-Stiftung resümiert denn auch, die Schweiz «hinkt weiterhin hinterher».
Projekte in der Windenergie stocken
Der Befund ist nicht neu. Die Schweiz rangiert seit Beginn der Untersuchungen 2010 stets in der Nähe des Tabellenendes. Ein genauer Blick auf die Zahlen verdeutlicht aber zweierlei. Zum einen: Der Ausbau der Windkraft stockt, zahlreiche Projekte sind seit Jahren blockiert, unter anderem wegen Einsprachen. 2010 lieferte Wind pro Kopf 5 Kilowattstunden pro Jahr, 2021 waren es knapp 17 – das ergibt Rang 25.
Zum anderen: Die Solarenergie entwickelt sich dynamischer. Die Pro-Kopf-Produktion ist seit 2010 um mehr als den Faktor 30 gestiegen und beträgt mittlerweile 356 Kilowattstunden pro Jahr. Im Ranking, das allein die Solarenergie berücksichtigt, liegt die Schweiz auf Platz 10 – das ist etwas besser als in den Anfangsjahren der Untersuchung, wenn auch schlechter als 2017 bis 2020.
ETH-Professor kritisiert die Politik
Die Publikation der Zahlen fällt in eine politisch wichtige Phase. Am Freitag berät die ständerätliche Umweltkommission über den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, dies im Rahmen des Bundesgesetzes über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Tobias Schmidt ist besorgt, dass die Politik nun die falschen Pflöcke einschlagen wird. Der Professor für Energie- und Technologiepolitik an der ETH Zürich, der im Beirat der Energie-Stiftung sitzt, kritisiert den «falschen Fokus» der Politik. Das zeigt ein Schreiben an die Kommissionsmitglieder, das dieser Redaktion vorliegt. Warum?
Die Schweizer Politik versucht, Investitionen in die Fotovoltaik auszulösen, indem sie diese mit einmaligen Investitionsbeiträgen unterstützt. Schmidt hält jedoch einen anderen Ansatz für sinnvoller: Förderinstrumente, welche die Investitionsrisiken mindern. «Der Fokus auf die Risikodeckelung ist das Erfolgsrezept im europäischen Ausland, das auch viel Schweizer Kapital anzieht», sagt Schmidt. Er verweist darauf, dass Schweizer Energieversorger und institutionelle Investoren in den letzten Jahren den Ausbau von grünem Strom im Ausland mit schätzungsweise 7 Milliarden Franken unterstützt haben.
In der Schweiz jedoch sind die Investitionsrisiken insbesondere bei den Fotovoltaikanlagen hoch, da die Erträge aus dem Verkauf des Solarstroms den variablen und manchmal sehr tiefen Preisen des Strommarkts ausgesetzt sind, so erklärt es Schmidt. Für Grossanlagen, wie sie etwa die Axpo auf der Muttsee-Staumauer im Kanton Glarus gebaut hat, schlägt er daher eine sogenannt gleitende Marktprämie vor. Hierbei garantiert der Staat dem Projektbetreiber, der am günstigsten offeriert, während mehrerer Jahre einen Preis pro produzierter Megawattstunde. Fördergeld fliesst nur, wenn der Marktpreis unter dem offerierten Preis liegt.
Kleine Solarstromproduzenten sollen Vergütung erhalten
Der Vorschlag findet in der Branche Unterstützung. «Die aktuelle Situation zeigt einmal mehr, wie unvorhersehbar der Marktpreis ist», sagt Axpo-Sprecher Martin Stucki. Die hohen Risiken, welche der Investor über all die Jahrzehnte zu tragen habe, würden durch eine gleitende Marktprämie minimiert.
Auch für die Besitzer kleiner Anlagen – typischerweise Hauseigentümer – hat ETH-Professor Schmidt einen Vorschlag. Diese sollen für den Solarstrom, den sie selber nicht brauchen und ins öffentliche Netz einspeisen, eine minimale, landesweit einheitliche Vergütung erhalten, welche die Amortisation dieser Anlagen über ihre Lebenszeit garantiert. Heute variiert dieser sogenannte Rückliefertarif je nach Energieversorger beträchtlich. Schmidt ist überzeugt, dass diese Rezepte wirken: «So schafft es auch die Schweiz, ihre inländischen solaren Ressourcen effektiv zu nutzen.»
Wie die Energiepolitiker in der kleinen Kammer entscheiden werden, ist schwierig abzuschätzen. Die Vorlage ist nun schon seit längerer Zeit in der Warteschlaufe. Der Bundesrat jedenfalls hat andere Pläne. Statt eines stabilen Rückliefertarifs für kleine Solarstromproduzenten will er Vergütungen, die sich am Marktpreis zum Zeitpunkt der Stromeinspeisung ausrichten. Auch von der gleitenden Marktprämie will er nichts wissen. Er anerkennt zwar, dass diese den Investoren eine «hohe Investitionssicherheit» gäbe, die Kehrseite wäre aber, dass die Preisrisiken «weitgehend sozialisiert» würden, also den Stromkonsumenten auferlegt.
Der Morgen
Der perfekte Start in den Tag mit News und Geschichten aus der Schweiz und der Welt.Fehler gefunden?Jetzt melden.